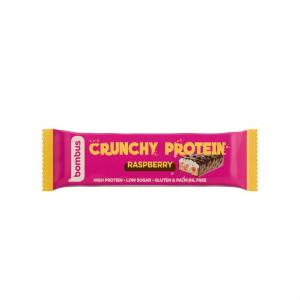Symptome eines Proteinüberschusses, die Sie überraschen könnten
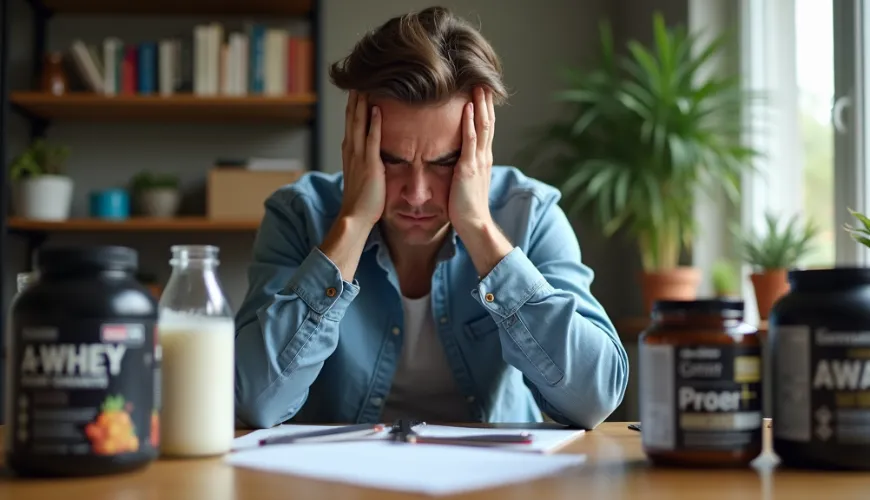
Unauffällige Anzeichen eines Proteinüberschusses
Proteine sind die grundlegenden Bausteine des Körpers. Sie sind unerlässlich für die Gewebereparatur, das Muskelwachstum sowie die Enzym- und Hormonproduktion. In den letzten Jahren hat jedoch ihre Rolle in der Ernährung möglicherweise zu viel Aufmerksamkeit erhalten. Fitnesskultur, kohlenhydratarme Diäten oder der Wunsch nach schnellem Gewichtsverlust führen viele Menschen dazu, große Mengen an Proteinen zu konsumieren – oft ohne fachliche Anleitung. Doch genauso wie ein Mangel gefährlich ist, kann ein Überschuss an Proteinen dem Körper schaden.
Obwohl man häufig Ratschläge wie „mehr Proteine für mehr Muskeln“ hört, wird selten erwähnt, dass ein Übermaß an Protein nicht sofort auffällt und seine Symptome unauffällig sein können. Der Körper kann sich zwar bis zu einem gewissen Grad anpassen, aber wenn er langfristig mit einseitiger oder unausgewogener Ernährung belastet wird, wird er sich früher oder später bemerkbar machen.
Was passiert im Körper, wenn Sie zu viele Proteine zu sich nehmen?
Wenn der Körper mehr Proteine aufnimmt, als er tatsächlich benötigt, muss er diesen Überschuss irgendwie verarbeiten. Proteine werden im Körper nicht als Reserve gespeichert – im Gegensatz zu Fetten oder Kohlenhydraten. Das überschüssige Protein muss daher aufwendig abgebaut werden. Dieser Prozess belastet vor allem die Leber und die Nieren, da sie am Abbau von Stickstoff beteiligt sind, der beim Abbau von Aminosäuren entsteht.
Probieren Sie unsere natürlichen Produkte
Der Körper arbeitet auf Hochtouren, um etwas loszuwerden, das in kleinen Mengen zwar nicht giftig ist, aber in großen Mengen ungesund wird. Es ist jedoch nicht schwarz-weiß – es kommt sehr darauf an, woher die Proteine stammen, wie sie verarbeitet sind und ob die Ernährung auch in anderen Nährstoffen ausgewogen ist.
Wie erkennt man einen Proteinüberschuss
Die Symptome eines Proteinüberschusses können unterschiedlich sein – einige sind leicht zu übersehen oder anderen Ursachen zuzuschreiben. Hier sind einige Warnsignale, die man nicht ignorieren sollte:
- Müdigkeit und Reizbarkeit – Paradoxerweise, obwohl viele glauben, dass mehr Proteine mehr Energie bedeuten, kann in der Praxis das Gegenteil der Fall sein. Ein Übermaß an Proteinen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kohlenhydratzufuhr kann zu einem Abfall des Blutzuckerspiegels führen, was Müdigkeit, schlechte Laune und Konzentrationsschwäche verursacht.
- Mundgeruch – Ketogene oder sehr kohlenhydratarme Diäten, die in der Regel proteinreich sind, können einen Zustand der Ketose hervorrufen. Ein Symptom davon ist unangenehmer Mundgeruch, der an Früchte oder Aceton erinnert und auch durch gründliche Mundhygiene nicht verschwindet.
- Verstopfung oder im Gegenteil Durchfall – Wenn Proteine Ballaststoffe (z.B. Gemüse, Obst, Vollkornprodukte) ersetzen, kann es zu Verdauungsstörungen kommen. Eines der häufigsten Ergebnisse ist Verstopfung. Bei einigen Menschen tritt im Gegenteil Durchfall auf, insbesondere wenn die Proteine hauptsächlich aus Milchprodukten stammen, die den Darm reizen können.
- Erhöhtes Schwitzen und unangenehmer Körpergeruch – Die Verdauung von Proteinen ist energieintensiver als bei anderen Makronährstoffen, was zu einer Erhöhung der Körpertemperatur führt. Der Körper schwitzt mehr, und da über den Schweiß auch einige Nebenprodukte des Proteinmetabolismus ausgeschieden werden, kann ein spezifischer, stechender Geruch auftreten.
- Kopf- und Gelenkschmerzen – Eine erhöhte Proteinzufuhr kann den Harnsäurespiegel im Blut ansteigen lassen, was mit Gelenkschmerzen oder sogar Gicht verbunden ist. Wenn Schmerzen ohne offensichtlichen Grund auftreten, sollte auch die Ernährung in Betracht gezogen werden.
- Erhöhter Durst und häufiges Wasserlassen – Der Körper benötigt mehr Wasser, um überschüssigen Stickstoff abzubauen und auszuscheiden. Daher kann eine erhöhte Proteinzufuhr mit größerem Durst, häufigem Wasserlassen und im Extremfall auch Dehydrierung verbunden sein.
Im realen Leben treten diese Symptome oft gleichzeitig auf. Beispielsweise kann eine Sportlerin, die versucht, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig eine kohlenhydratarme Diät mit Quark, Hühnerfleisch und Proteinshakes hält, nach einigen Wochen an Verstopfung, Müdigkeit und Kopfschmerzen leiden. Bevor sie erkennt, dass das Problem im falschen Verhältnis der Nährstoffe liegt, vergehen oft mehrere Monate.
Wie viel Protein ist zu viel?
Die empfohlene tägliche Proteinzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen liegt bei etwa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für Sportler oder Personen in bestimmten Zuständen (z.B. Rekonvaleszenz) kann dieser Wert höher sein – bis zu 1,6 oder in Ausnahmefällen 2 Gramm pro Kilogramm. Aber viele Menschen nehmen heute routinemäßig 3–4 Gramm pro Kilogramm zu sich – oft ohne es zu merken.
Zum Beispiel können ein 100-Gramm-Steak, Joghurt, ein Ei und ein Proteinshake zusammen bis zu 100 Gramm Protein ausmachen – und das ist für eine Person mit einem Gewicht von 60 kg bereits das Doppelte der empfohlenen Tagesdosis.
Darüber hinaus ist es wichtig, zwischen Qualität und Herkunft der Proteine zu unterscheiden. Verschiedene Studien zeigen, dass pflanzliche Proteine (z.B. aus Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen oder Vollkorngetreide) andere Auswirkungen auf den Körper haben als tierische. Während pflanzliche Proteine mit einem verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, treten bei einer Ernährung mit einem Übermaß an tierischen Produkten (insbesondere rotes Fleisch und Wurstwaren) häufiger entzündliche Prozesse und eine höhere Belastung der Nieren auf.
Nachhaltiger Umgang mit Proteinen
In der heutigen Zeit, in der die Ernährung oft von Modetrends und Marketing für Nahrungsergänzungsmittel beeinflusst wird, ist es leicht, eine einseitige Perspektive einzunehmen. Eine gesunde Menge an Proteinen sollte Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein, und nicht ihr Mittelpunkt. Eine Vielfalt bei den Proteinquellen unterstützt nicht nur die Gesundheit des Darmmikrobioms, sondern verringert auch das Risiko einer Überlastung des Organismus.
Eine entscheidende Rolle spielt auch die Zubereitungsart der Lebensmittel – anstelle von gebratenem Fleisch oder industriell verarbeiteten Proteinriegeln ist es besser, natürliche und schonend zubereitete Lebensmittel zu wählen. Beispielsweise sind Linsen, fermentierter Tempeh, Nüsse, Samen oder hochwertige pflanzliche Alternativen großartige Proteinquellen, die zudem die Nachhaltigkeit fördern und den Planeten schonen.
Wie die Ernährungsexpertin Marion Nestle sagt: „Gesundheit geht nicht darum, ein einziges Superfood zu essen, sondern um das Gesamtbild unserer täglichen Entscheidungen."
Gerade dieser Ansatz – also Nachhaltigkeit, Vielfalt und Mäßigung – kann der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung nicht nur zu Proteinen, sondern zur Ernährung im Allgemeinen sein. Mahlzeiten sollten nicht nur ernährungsphysiologisch vorteilhaft, sondern auch eine Freude sein. Und wenn unerklärliche gesundheitliche Probleme auftreten, lohnt es sich vielleicht, über die Frage nachzudenken: Sind in meiner Ernährung nicht doch zu viele Proteine?