
Warum das Hochstapler-Syndrom verbreitet ist und wie man damit umgeht
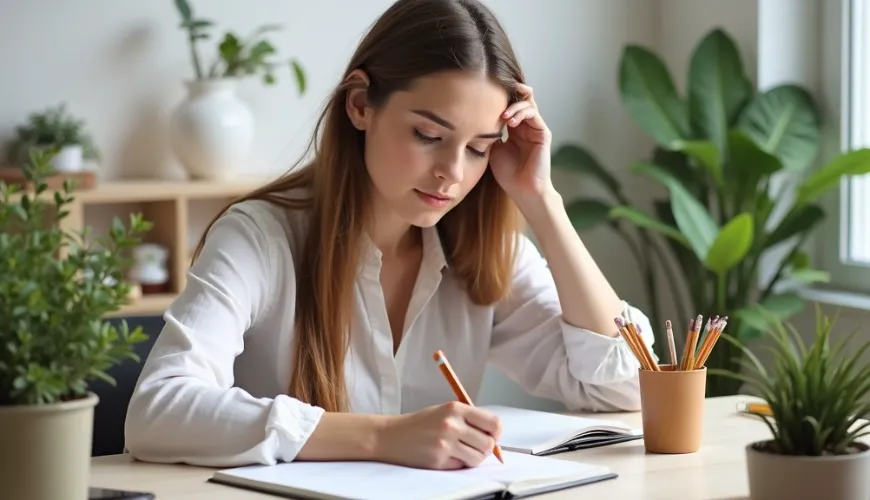
Was, wenn Sie nicht so gut sind, wie andere denken? Der Hochstapler-Syndrom und wie man damit lebt
Im Kopf klingt es etwa so: „Ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Ich hatte einfach nur Glück. Wenn die Leute wüssten, wer ich wirklich bin, würden sie mich nicht für erfolgreich halten." Wenn Ihnen diese Gedanken nicht fremd sind, erleben Sie möglicherweise das Hochstapler-Syndrom – ein psychologisches Phänomen, das selbst den größten Erfolg in Frage stellen kann.
Obwohl erst in den letzten Jahren mehr darüber gesprochen wurde, ist dieser Zustand keine Neuheit. Bereits 1978 beschrieben ihn die Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes, als sie feststellten, dass viele erfolgreiche Frauen dazu neigen, ihre Erfolge dem Zufall, der Überschätzung durch andere oder übermäßigem Einsatz zuzuschreiben, nicht ihren Fähigkeiten. Und es waren nicht nur Frauen – auch Männer fühlten sich ähnlich, sprachen aber weniger darüber.
Heute wird geschätzt, dass bis zu 70 % der Menschen in einer bestimmten Lebensphase Gefühle erleben, die diesem Syndrom entsprechen. Schauspieler wie Tom Hanks, Unternehmer wie Howard Schultz oder die berühmte Schriftstellerin Maya Angelou haben darüber gesprochen. Und obwohl es scheinen mag, dass es nur außergewöhnlich erfolgreiche Menschen betrifft, ist die Realität anders – das Hochstapler-Syndrom kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Beruf oder erzielten Ergebnissen.
Warum fühlen wir uns wie Betrüger?
Der Kern des Hochstapler-Syndroms (manchmal im Englischen als imposter syndrome bezeichnet) liegt in der tief verwurzelten Überzeugung, dass unsere Erfolge unverdient sind. Menschen mit diesem Syndrom glauben, dass sie nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, dass ihr Umfeld sich irrt, wenn es sie für kompetent hält, oder dass alles, was sie erreicht haben, das Ergebnis von Zufall ist.
Oft beginnt es schon während des Studiums, wenn sich Studenten nicht trauen, sich zu äußern, weil sie glauben, dass ihre Kommilitonen mehr wissen. Später, im Beruf, haben sie Angst, um eine Beförderung zu bitten oder verantwortungsvollere Aufgaben anzunehmen, weil sie das Gefühl haben, es nicht zu verdienen. Und selbst wenn sie Erfolg haben – einen Artikel veröffentlichen, ein Stipendium erhalten, ein Team leiten, ein Unternehmen gründen – statt Freude kommt Angst: „Diesmal hat es geklappt, aber beim nächsten Mal wird sich sicher herausstellen, dass ich es nicht kann."
Das Syndrom äußert sich unterschiedlich – einige Menschen ziehen sich aus Situationen zurück, in denen sie bewertet werden könnten, andere überlasten sich, arbeiten bis spät in die Nacht und versuchen ständig, ihre vermeintlichen Mängel auszugleichen. Das Ergebnis ist chronischer Stress, Angst, Burnout und in einigen Fällen auch Depressionen.
Probieren Sie unsere natürlichen Produkte
Es geht nicht nur um geringes Selbstwertgefühl
Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass das Hochstapler-Syndrom nur eine andere Form von geringem Selbstwertgefühl ist. Die Realität ist jedoch komplexer. Viele Menschen mit diesem Syndrom wirken nach außen selbstsicher, sind redegewandt, erfolgreich, haben Erfahrung – aber innerlich kämpfen sie mit tiefen Zweifeln an ihrem eigenen Wert. Interessant ist, dass dieses Phänomen oft gerade diejenigen betrifft, die wirklich kompetent sind, weil sie die Komplexität ihrer Fachgebiete am besten verstehen und sehen, wie viel sie noch „nicht können".
Zudem spielt auch der kulturelle und soziale Kontext eine Rolle. Menschen aus marginalisierten Gruppen – zum Beispiel Frauen in technischen Berufen, Menschen anderer Ethnien oder die erste Generation von Hochschulabsolventen in der Familie – kämpfen häufiger mit diesem Syndrom, weil sie sich wie Außenseiter in einem Umfeld fühlen, in dem sie nicht ausreichend repräsentiert sind. „Selbstzweifel werden zur Norm, wenn niemand um dich herum dir ähnlich ist," sagte einmal eine Professorin einer amerikanischen Universität in einem Interview mit dem Harvard Business Review.
Wie geht man damit um?
Wenn Sie sich darin wiedererkennen, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Die gute Nachricht ist, dass das Hochstapler-Syndrom bewältigt werden kann – nicht unbedingt beseitigt, aber gelernt, damit zu leben, sodass es Sie nicht einschränkt.
Ein erster Schritt ist die Benennung des Problems. Viele Menschen erkennen erst, wenn sie über das Syndrom lesen oder in einem Vortrag darüber hören, dass ihre Gefühle nicht einzigartig sind. Allein die Erkenntnis, dass es so etwas wie das Hochstapler-Syndrom gibt, kann Erleichterung bringen.
Weiterhin hilft es, über seine Gefühle mit anderen zu sprechen – mit Kollegen, Freunden, einem Mentor. Ein offenes Gespräch zeigt oft, dass auch andere ähnliche Zweifel haben. Es entsteht Raum für den Austausch von Erfahrungen, und das Gefühl der Isolation, das dieses Syndrom oft begleitet, wird natürlicher abgeschwächt.
Hilfreich ist auch, die eigenen Erwartungen zu überdenken. Menschen, die an diesem Syndrom leiden, haben oft übermäßig hohe Ansprüche an ihre eigene Leistung. Sie lernen, dass es reicht, „gut genug" zu sein, nicht perfekt. Das bedeutet nicht, die Ambitionen zu senken, sondern eine gesündere Beziehung zu sich selbst zu haben.
Am Ende ist es gut, sich bewusst an die eigenen Erfolge zu erinnern – zum Beispiel ein Tagebuch zu führen, in dem man jede Woche notiert, was einem gelungen ist, was man gelernt hat, was man geschafft hat. Ein solcher Überblick über konkrete Beweise kann in Momenten des Zweifels helfen, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.
Ein echtes Beispiel - Tereza, angehende Architektin
Tereza hat Architektur mit Auszeichnung studiert und bekam gleich nach dem Studium eine Stelle in einem angesehenen Atelier. Trotzdem hatte sie ständig das Gefühl, dass es ein Fehler war, sie einzustellen. Als sie einem Kunden einen Entwurf präsentierte, fühlte sie sich, als spiele sie Theater – als täusche sie nur vor, zu wissen, was sie tut. „Ich hatte das Gefühl, dass alle anderen talentierter, erfahrener, selbstsicherer sind," sagt sie. Nach einigen Monaten der Erschöpfung bemerkte sie, dass diese innere Stimme sich ständig wiederholte. Therapie half ihr, aber auch Gespräche mit Kollegen, die ähnliche Erfahrungen teilten. Heute fragt sie sich nicht mehr, ob sie gut genug ist. Vielmehr fragt sie, was sie weiter lernen kann – und das bringt sie voran.
Wenn der innere Kritiker die Realität übertönt
Das Hochstapler-Syndrom ist wie eine kleine Stimme im Kopf, die alles, was wir tun, in Frage stellt. Sie behauptet, wir würden unser Umfeld belügen, wir seien nicht kompetent genug, und alles, was uns gelungen ist, sei Zufall. Aber wie die amerikanische Psychologin Valerie Young sagt, die sich seit über zwanzig Jahren mit diesem Thema beschäftigt: „Echte Hochstapler haben diese Zweifel nicht."
Das bedeutet, dass gerade das Zweifeln ein Zeichen dafür ist, dass Ihnen die Ergebnisse wichtig sind, dass Sie Verantwortung tragen und Ihre Fähigkeiten reflektieren. Menschen ohne einen Funken Selbstreflexion oder Empathie leiden selten am Hochstapler-Syndrom.
Wenn Sie also Unsicherheit, Angst empfinden oder dazu neigen, Ihre Fähigkeiten zu bagatellisieren, kämpfen Sie möglicherweise mit diesem stillen, aber sehr häufigen inneren Kritiker. Und auch wenn seine Stimme nie ganz verschwinden wird, können Sie lernen, ihm mit Abstand zuzuhören – und ihm allmählich nicht mehr zu glauben.
Denn Erfolg ist kein Beweis für Zufall. Und Anerkennung von anderen ist kein Irrtum. Es ist das Ergebnis Ihrer Arbeit, Ihrer Leidenschaft, Ihrer Anstrengung. Und Sie verdienen sie.


